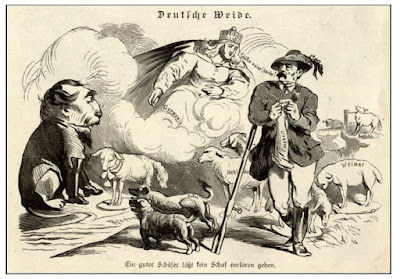Gerhart Hauptmann und Romain
Rolland im „Dialog“ – Dimensionen des Textverstehens
Heinz-Helmut Lüger (Koblenz-Landau)
«Il serait temps de renoncer à des idées qui
ne
résistent pas à un examen sérieux.» (Bréal
1891: 619)
Abstract
(English)
Understanding
documents that stem from a foreign culture, undoubtedly, does not
only require knowledge about linguistic rules but also specific
knowledge about the cultural embedding of such texts. In other words,
text comprehension is not possible without a minimum of contextual
information. On the one hand, this concerns objects and facts which
are explicitly mentioned; on the other hand, it may include
background circumstances, implicit attitudes, allusions, and,
occasionally, also historical aspects. The focus on competences,
introduced by the Common European Framework of Reference for
Languages, cannot fully comply with these conditions.
Keywords: Cultural studies, foreign language learning, focus on
competences,
German-French relations
Abstract
(Deutsch)
Die
Rezeption landeskundlicher Dokumente erfordert bekanntlich nicht nur
sprachliche, sondern ebenso eine Reihe kulturspezifischer Kenntnisse.
Mit anderen Worten: Textverstehen kommt ohne ein minimales
Kontextwissen nicht aus. Diese Kontexte betreffen zum einen
Gegenstände und Sachverhalte, auf die explizit Bezug genommen wird,
zum andern betreffen sie mitgemeinte Hintergründe, Einstellungen,
Anspielungen, oft auch historische Aspekte. Die mit dem
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen eingeführte
Kompetenzorientierung kann dem nur eingeschränkt gerecht werden.
Stichwörter: Landeskunde, Fremdsprachenlernen,
Kompetenzorientierung,
deutsch-französische Beziehungen
1 Ausgangspunkt: Deutsch-französische Beziehungen
Die
deutsch-französischen Beziehungen sind ohne Frage ein Standardthema
sowohl in der Frankreichforschung wie auch in der Frankreichkunde.
Die inhaltliche Relevanz erscheint offenkundig, lassen sich doch
auf diesem Wege zahlreiche Bezüge zu den beiden Gesellschaften, zu
den soziokulturellen Verhältnissen, zu den politischen Prioritäten,
den Konflikten und Kooperationen und zu unterschiedlichen Etappen von
Abgrenzung und Annäherung, von Feindschaft und Freundschaft
herstellen. Einer zusätzlichen Begründung als Untersuchungs- oder
als Vermittlungsgegenstand bedarf es daher an dieser Stelle nicht
(Große 2008: 300ff).
Nicht mehr ganz so selbstverständlich erscheint dies
jedoch, wenn man von den Kompetenzstandards des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens (GeR) ausgeht.
So liest man etwa zum „Leseverstehen allgemein“ bezüglich der
Niveaustufe C1:
Kann
lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch wenn diese nicht dem
eigenen Spezialgebiet angehören, sofern schwierige Passagen
mehrmals gelesen werden können. (GeR 2001: 74)
Landeskundliches Lernen wird im GeR nicht eigens zum
Thema gemacht; zur Vermittlung kulturellen Wissens finden sich ebenso
wenig konkrete Aussagen wie zur Einbeziehung historischer
Informationen. Insofern verwundert nicht, wenn es auch für den
Bereich des Interkulturellen bei ähnlich allgemein formulierten
Zielvorstellungen bleibt. Aufschlußreich ist die folgende
Auflistung:
Interkulturelle
Fertigkeiten umfassen:
- die Fähigkeit, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in Beziehung zu setzen;
- kulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, eine Reihe verschiedener Strategien für den Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen zu identifizieren und zu verwenden;
- die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der fremden Kultur zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverständnissen und Konfliktsituationen umzugehen;
- die Fähigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden. (GeR 2001: 106)
Noch deutlicher zeigt sich die Abkehr von inhaltlicher
Konkretisierung, wenn man z. B. hochschulinterne Hinweise und
Sprachregelungen zur Umsetzung der Kompetenzstandards hinzuzieht:
Es geht nicht mehr um die Beschreibung von Lehrinhalten („Input“),
sondern vielmehr um das, was Studierende nach Abschluss eines Moduls
oder eines Studiengangs in der Lage sind zu tun („Output“).
(Baumann / Benzing 2013: 3)
Lernergebnisse sind keine Lerninhalte oder Themen.
(Baumann / Benzing 2013: 8; Hervorhebung im Original)
Bei der Beschreibung von Lernergebnissen / Kompetenzen
empfiehlt sich die Verwendung von Verben, die direkt beobachtbare
Handlungen beschreiben. Zu vermeiden sind hingegen Verben, die eher
den Lernprozess als sein Ergebnis in den Blick nehmen (z. B.:
wissen, verstehen, begreifen, haben gelernt, kennen, würdigen,
vertraut sein). Werden dennoch solche Verben verwendet, empfiehlt es
sich zu beschreiben, wie diese Verben (Kompetenzen) erfasst werden
sollen (z. B.: das Wissen über xy wird anhand von …
nachgewiesen). (Baumann & Benzing 2013: 2013: 10)
Es ist also die mit dem GeR neu etablierte
Output-Orientierung, die Konzentration auf direkt Beobachtbares
und Nachweisbares, wodurch „Lerninhalte oder Themen“ in den
Hintergrund geraten. Und es dürfte schwerfallen, der folgenden
Beobachtung Gessers zu widersprechen:
Im Gegensatz zum Lehrplan äußert sich der GER nicht zu konkreten
Inhalten, anhand derer die Kompetenzen erreicht werden können.
(Gesser 2006: 7)
Diese
inhaltliche Unverbindlichkeit leistet ohne Frage Bestrebungen
Vorschub, die einem sprachpraktischen Verständnis von Lesekompetenz
den Vorzug geben und die ausdrückliche Einbeziehung zielkultureller
Zusammenhänge eher vermeiden. An Kritik einer solchen Position hat
es in den letzten Jahren nicht gefehlt; wichtige Stichworte waren
„Entkulturalisierung“, „Ausbildung statt Bildung“,
„Rückfall in eine
fremdsprachendidaktische Steinzeit“ oder, da Sprachstandards
als Bildungsstandards ausgegeben werden, schlicht
„Etikettenschwindel“1.
Es scheint in der Tat so zu sein, daß mit dem Postulat von
Operationalisierung und Evaluierung des Fremdsprachenlernens
Inhaltliches leicht auf der Strecke bleibt – ein Einwand, der
bereits in den 1980er Jahren mehrfach Gegenstand
fremdsprachendidaktischer Diskussionen war. Die Notwendigkeit der
Einbeziehung landeskundlicher Hintergründe für das Textverstehen
konnte seitdem zwar als unumstößlich und selbstverständlich
gelten, mit der Kompetenzdidaktik und ihrer „Pädometrie“,
so Wernsing (2015: 24), rückt die wirkliche Welt jedoch wieder in
den Hintergrund.
In
den anschließenden Abschnitten geht es vor allem darum, anhand eines
konkreten Beispiels noch einmal zu veranschaulichen, worin die
inhaltliche Komplexität – die prinzipielle
Mehrdimensionalität – von Textverstehen bestehen kann. Diese
(keineswegs neue) Einsicht dürfte schließlich auch dazu beitragen,
Einseitigkeiten und Begrenzungen eines Verstehenskonzepts
aufzuzeigen, das sich verstärkt an leicht evaluierbaren sprachlichen
Fertigkeiten orientiert und auf eine Anbindung an soziale, politische
und historische Zusammenhänge verzichtet. Als Beispiel dient
eine Auseinandersetzung, wie sie Gerhart Hauptmann und Romain
Rolland vor ungefähr einhundert Jahren zu Beginn des Ersten
Weltkriegs geführt haben2.
Ausgangspunkt ist eine längere Erklärung Gerhart Hauptmanns unter
dem Titel „Gegen Unwahrheit!“ in der Vossischen
Zeitung vom 26.8.1914,
auszugsweise im Anhang als Text (1) wiedergegeben.
In dem genannten Beitrag wendet sich Gerhart Hauptmann
vehement vor allem gegen ausländische Kritiker, die das Vorgehen
deutscher Truppen zu Beginn des Krieges scharf verurteilen.
Hintergrund ist folgender Sachverhalt: Belgien, das wie Luxemburg
1914 zu den neutralen Staaten gehört, wird von der Regierung des
Deutschen Reichs in einem Ultimatum aufgefordert, den Durchzug
deutscher Truppen zu erlauben. Die Ablehnung dieser Forderung hält
das deutsche Militär jedoch nicht vom völkerrechtswidrigen
Einmarsch ab, und bereits in den ersten Kriegswochen erlebt
Belgien zahlreiche Übergriffe. Besondere Empörung ruft das
Massaker von Dinant hervor, bei dem nahezu 700 Zivilpersonen
getötet werden, darunter zahlreiche Geiselerschießungen. Nicht
minder empört reagiert man, als nur wenige Tage später deutsche
Truppen die Stadt Löwen zerstören und dabei auch die berühmte
Universitätsbibliothek der Universität in Flammen aufgehen
lassen. Die Deutschen werden international fortan als die neuen
Hunnen, als Barbaren, die vor keinem Kriegsverbrechen
zurückschrecken, an den Pranger gestellt. Als politisch fatal
erweisen sich die Ereignisse, einschließlich der internationalen
Kritik, auch insofern, als die deutsche Seite auf diese Weise gerade
bei den neutralen Staaten jeglichen Rückhalt verspielt.
Intellektuelle wie Gerhart Hauptmann, bekannter Autor und 1912
Literaturnobelpreis-Träger, bemühen sich in dieser Situation um
Schadensbegrenzung, weisen die Vorwürfe energisch zurück,
bestreiten sogar die Vorfälle3
und versuchen, den deutschen Friedenswillen und den Status als „altes
Kulturvolk“ hervorzuheben:
(1a) [1] Wir sind ein eminent friedliebendes Volk. Der oberflächliche
Feuilletonist Bergson in Paris mag uns immerhin Barbaren nennen, der
große Dichter und verblendete Gallomanne Mäterlinck uns mit
ähnlichen hübschen Titeln belegen, nachdem er uns früher „das
Gewissen Europas“ genannt hat. Die Welt weiß, daß wir ein altes
Kulturvolk sind. Die Idee des Weltbürgertums hat nirgends
tiefere Wurzeln geschlagen als bei uns. [...]
Gleichzeitig geht es Hauptmann darum, bestimmte Autoren,
die sich kritisch zu den Ausschreitungen in Belgien äußern, zu
diffamieren und lächerlich zu machen. Dies trifft nicht zuletzt, wie
in (1) dokumentiert, den belgischen Dichter und
Literaturnobelpreis-Träger von 1911, Maurice Maeterlink, und den
französischen Philosophen und Schriftsteller Henri Bergson.
Gerade letzterer zieht viele negative Kommentare auf sich und wird
als „oberflächlicher Feuilletonist“ und als
„Salon-Philosophaster“ (s. (1) [2]) etikettiert. Anlaß ist
eine Rede vom 8. August 1914, in der es u.a. heißt: « La
lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la
civilisation contre la barbarie. » (Bergson 1972: 1102). Es
dürfte wohl gerade der Vorwurf des Barbarentums sein, der Hauptmann
jeden Maßstab vergessen und zu diesen persönlichen Verhöhnungen
greifen läßt – der so apostrophierte „Salon-Philosophaster“
hat seit 1900 eine Professur für Philosophie an der Pariser
Elite-Hochschule École normale
supérieure und am international renommierten
Collège de France
inne, 1901 wird er ins Institut de France
(Académie des sciences morales et politiques), 1914 in die
Académie française
aufgenommen.
Insgesamt
ergibt sich: Die deutsch-französischen Beziehungen erleben einen
neuen Tiefpunkt, dies sowohl auf der staatlich-politischen Ebene als
auch auf der Ebene des persönlichen Austausches zwischen Künstlern,
Literaten und Wissenschaftlern. Nicht alle Informationen sind dem
Text selbst zu entnehmen, insbesondere die Einschätzung der
gegebenen Bewertungen setzt zusätzliche Kenntnisse, und zwar landes-
und personenspezifische, voraus. Auf weitere, für die
Bedeutungszuschreibung relevante Aspekte wird, wiederum anhand der
Stellungnahme Gerhart Hauptmanns, im folgenden Abschnitt verwiesen.
2 Verstehenskontexte
Das deutsch-französische Verhältnis wird bei Hauptmann
relativ ausführlich, wenn auch perspektivisch verkürzt,
angesprochen:
(1b) [2] [...] Ich spreche es aus: Wir haben und hatten keinen
Haß gegen Frankreich: Wir haben einen Kultus mit der bildenden
Kunst, Skulptur und Malerei und mit der Literatur dieses Landes
getrieben. Die Weltschätzung Rodins wurde von Deutschland aus in die
Wege geleitet, wir verehren Anatole France. Maupassant, Flaubert,
Balzac wirken bei uns wie deutsche Schriftsteller. [...]
[3] Es war schmerzlich zu bedauern, daß Deutschland und
Frankreich politisch nicht Freunde sein konnten. Sie hätten es sein
müssen, weil sie Verwalter des kontinentalen Geistesgutes, weil sie
zwei große durchkultivierte europäische Kernvölker sind. Das
Schicksal wollte es anders. Achtzehnhundertsiebzig erkämpften
sich die deutschen Stämme die deutsche Einheit und das Deutsche
Reich. Unter diesen Errungenschaften ward unserm Volk eine mehr
als vierzigjährige friedliche Epoche beschieden. Eine Zeit des
Keimens, des Wachsens, des Erstarkens, des Blühens, des
Fruchttragens ohnegleichen. [...]
Hauptmann macht einen Unterschied zwischen der
allgemeinen Wertschätzung französischer Kunst und französischen
Autoren einerseits und einer schicksalsbedingten politischen
Gegensätzlichkeit andererseits. Diese Darstellung ist
ergänzungsbedürftig:
Abb. 1: Deutsch-französische Vorbehalte (Kladderadatsch, 31.3.1867)
Spätestens seit Königgrätz bzw. Sadowa, der
österreichischen Niederlage gegen Preußen im Jahre 1866, der
anschließenden Auflösung des Deutschen Bundes und der Neugründung
des Norddeutschen Bundes unter preußischer Führung kommt es zu
einer Veränderung des deutsch-französischen Verhältnisses.
Die neue Machtposition Preußens erregt das Mißtrauen Frankreichs,
und Napoleon III. fühlt sich sogar zur Forderung territorialer
Kompensationen veranlaßt. Die bis dahin überwiegend germanophile
Haltung beginnt zu bröckeln, die Wirkung des von Mme de Staël
in ihrem Buch De l’Allemagne
(geschrieben 1810) entworfenen Deutschland-Bildes beginnt zu
verblassen. Bezeichnend erscheint hier u.a. die Reaktion eines
Edgar Quinet, ein von deutscher Kultur und Philosophie zunächst
durchaus überzeugter Historiker und Schriftsteller, der bereits 1842
in einem Zeitschriftenbeitrag, überschrieben mit « La
Teutomanie », eine Abkehr von allen nationalistischen Tendenzen
und eine Rückbesinnung auf vergangene Werte und Vorstellungen
fordert:
Que l’Allemagne revienne donc au plus tôt à son génie naturel,
qu’elle soit telle que nous l’avons connue, et les sympathies de
l’étranger ne lui manqueront pas. (Quinet 1842: 938)
Und auf deutscher Seite sorgen
bestimmte Reaktionen des französischen Kaisertums ebenfalls für
eine Abkühlung der Beziehungen. Als Beispiel der gegenseitigen
Feindbild-Konstruktion diene hier die in Abb. 1 wiedergegebene
Karikatur: Bismarck fungiert als der Beschützer der Herde der
deutschen Staaten, und zwar gegenüber Napoleon III., der – als
Löwe dargestellt – von Baden und Bayern verbellt wird4;
im Hintergrund erscheint die Germania mit dem Appell an Bismarck:
„Schütze meine Herde!“ Die bereits 1867 zum Ausdruck kommenden
Spannungen zwischen Preußen und Frankreich führen dann zum Krieg
von 1870/1871 und damit zu einem radikalen Wandel der
deutsch-französischen Beziehungen. Der Erbfeindschafts-Mythos kann
sich nun (vor allem auf deutscher Seite) ungehindert entfalten; doch
auch in Frankreich dominieren starke nationalistische,
deutschfeindliche Tendenzen (Jeismann 1992: 262ff).
Abb. 2: Deutsch-französischer Dauerkonflikt
Ein großes Konfliktfeld stellt die Annexion des Elsaß
und eines Teils von Lothringen dar, ebenso die anschließend
betriebene Germanisierung. Bei Hauptmann ist in (1) [3]
lediglich die Rede von den „deutschen Stämmen“, die sich die
deutsche Einheit und das Deutsche Reich erkämpft hätten; dies habe
letztlich eine „vierzigjährige friedliche Epoche“ begründet,
eine Zeit „des Blühens, des Fruchttragens ohnegleichen“.
Angesichts solcher Formulierungen, die im übrigen sehr an die
Reden des deutschen Kaisers und des Reichskanzlers in den ersten
Augusttagen 1914 erinnern (Lüger 2015), verwundert nicht, daß das
Problem des „Reichlandes“ Elsaß-Lothringen nicht in den Blick
genommen wird, schon gar nicht die damit verbundenen
unterschiedlichen Interessen und Perspektiven (Abb. 2): Aus der
Sicht Preußens handelt es sich bei der Annexion um eine
Maßnahme der „Selbsterhaltung“, und man müsse, so die
Bildunterschrift, „der Bestie die Krallen abschneiden, damit
man künftig Ruhe vor ihr“ habe (die Karikatur zeigt Bismarck, u.a.
sekundiert vom preußischen König Wilhelm, beim Abtrennen dieser
Krallen, nämlich vom Elsaß und von Lothringen). Dieser
Position entgegengesetzt gibt die französische Karikatur in Abb. 2
eine Haltung wieder, wonach es der Patriotismus gebiete, den
Gedanken an die Rückgewinnung Elsaß-Lothringens, eines
integralen Bestandteils Frankreichs (vgl. die Plazierung der
Landesbezeichnung France)
präsent zu halten und an die junge Generation weiterzugeben.
Die
Karikaturen sind gerade wegen ihres pointierenden Charakters
symptomatisch für die von beiden Seiten praktizierte Propaganda
und die letztlich unversöhnlichen Positionen. Sie
veranschaulichen ebenso, in welcher Weise die Aussagen und
Anspielungen Hauptmanns in (1) [2-3] historisch und politisch zu
erweitern bzw. zu korrigieren wären. Bezüglich der dabei bemühten
landeskundlichen Informationen ist Vollständigkeit prinzipiell
nicht sinnvoll anzustreben; wie viel an solchen Wissensbeständen
herangezogen wird, ist immer auch eine Frage der Verstehenstiefe und
der Interessen des Rezipienten.
Ein weiterer Aspekt sei in diesem Zusammenhang noch
genannt: Viele der gemachten Äußerungen stehen in einer mehr oder
weniger direkten Beziehung zu Vorgängertexten. Dies gilt zum Teil
auch für die Erklärung Gerhart Hauptmanns, und zwar besonders
dann, wenn es um politisch wesentliche Punkte geht: z. B. bei
der Betonung der Friedensliebe, der Verteidigung kultureller Werte
und der pauschalen Zurückweisung von Kritik – hier sind
intertextuelle Bezüge zu regierungsoffiziellen Verlautbarungen
unübersehbar. So tauchen einige Formulierungen des folgenden
Auszugs wie vorgeprägte Versatzstücke immer wieder auf:
(1c) [7] [...] Das deutsche Volk, die deutschen Fürsten, an der
Spitze Kaiser Wilhelm der Zweite, haben keinen anderen Gedanken
gehabt, als durch Heer und Flotte den Bienenstock des Reiches, das
fleißige, reiche Wirken des Friedens, zu sichern. [...]
[8]
Der Krieg, den wir führen und der uns aufgezwungen ist, ist ein
Verteidigungskrieg. Wer das bestreiten wollte, der müßte sich
Gewalt antun. [...]
[9]
Wer aber hat diesen Krieg angezettelt? Wer hat sogar den Mongolen
gepfiffen, diesen Japanern, daß sie Europa hintertückisch und feige
in die Ferse beißen? Jedenfalls doch unsere Feinde, die, umgeben von
Kosakenschwärmen, für die europäische Kultur zu kämpfen
vorgeben. [...]
Auf einzelne Nachweise wird hier verzichtet, zumal die
Reden zum Kriegsausbruch bereits diverse Übereinstimmungen
liefern. Man kann solche Aussagen nun auch auf Stellungnahmen
beziehen, die zu ihnen in einem diametralen Gegensatz stehen. Als
Beispiel ließen sich Vorschläge zur Lösung des Elsaß-Problems
nennen, die allerdings meist ignoriert werden, um den einmal
eingeschlagenen Weg, um die These von der politischen
Zwangsläufigkeit (bis hin zum Kriegsausbruch) nicht revidieren zu
müssen. Gleichsam die Probe aufs Exempel liefert die Idee Michel
Bréals zur Neutralitäts-Erklärung von Elsaß-Lothringen:
Je crois qu’il faut demander cette neutralisation comme le seul
moyen d’obtenir pour l’Europe une paix solide et durable.
Neutralisation sous la protection des grandes puissances, qui n’ont
pas plus d’intérêt que nous à vivre dans cet état perpétuel de
défiance et d’armement. […]
Je la demande aussi dans l’intérêt de l’Alsace, qu’on a un
peu trop oubliée jusqu’à présent, et passée sous silence. Elle
deviendra le pays d’élection pour tous ceux qui aiment la liberté
et le progrès pacifique. L’Université de Strasbourg deviendra la
continuation de l’ancienne université où Goethe a passé
quelques-uns des meilleurs jours de sa vie. (Bréal 1913: 36)
Es versteht sich, daß von diesem Vorschlag (wie auch
von anderen ähnlich orientierten Initiativen zur
Friedenssicherung) in den Ausführungen Hauptmanns nicht die
geringste Spur zu finden ist. Solche Überlegungen hätten, wie schon
angedeutet, die eindimensionale und schwarz-weiß-malende
Argumentation sowie die einseitigen Schuldzuweisungen noch
fragwürdiger erscheinen lassen, als sie es ohnehin schon sind.
Insofern sind die absichtsvollen Auslassungen durchaus als
konstitutiv für den vorliegenden Text zu betrachten.
Abb. 3: Kontexte des Leseverstehens
Eines sollte deutlich geworden sein: Die Einschätzung,
die kritische Einordnung des vorliegenden Beitrags von Gerhart
Hauptmann und der mitherangezogenen französischen Dokumente setzt
ohne Frage einerseits voraus, „komplexe Texte im Detail verstehen“
oder „feine stilistische Unterschiede und implizite Bedeutungen
erfassen“ zu können, wie vom GeR (2001: 74) mit den
Kompetenzstandards vorgesehen. Darüber hinaus ist jedoch ein
bestimmtes Kontextwissen erforderlich, wie es sich kaum mit diesen
allgemeinen Hinweisen zum Leseverstehen angeben läßt. Benötigt
werden vielmehr – und zwar sowohl für in der Zielsprache
geschriebene Texte also auch für muttersprachliche Dokumente –
Informationen und Kenntnisse, die die Rezeption von Texten oder
bildlichen Darstellungen in ihrem kommunikativen Zusammenhang
ermöglichen (Abb. 1). Dies betrifft zunächst das
Zuordnenkönnen bestimmter, im Text (oder im Bild) vorhandener
Angaben zu den gemeinten Ereignissen, Sachverhalten, Personen
und Orten (= Kontextwissen im engeren Sinne). Auf einer
allgemeineren Ebene ist landeskundliches Hintergrundwissen
einzubeziehen (= Kontextwissen im weiteren Sinne): Wie gestaltet sich
z. B. das deutsch-französische Verhältnis zu einem bestimmten
Zeitpunkt? Wie sehen die Konstellationen der politischen Akteure
aus, welche Handlungsmotivationen, welche Ziele, welche Positionen
sind im Spiel? Wie lassen sich gegebene Entscheidungen,
Stellungnahmen oder Handlungsabläufe begründen? Schließlich kommt
es darauf an, auf dieser Grundlage zu einer kritischen Einordnung, zu
einer problematisierenden Auseinandersetzung bezüglich der
gewählten Materialien zu gelangen. Im konkreten Fall: den Text
Hauptmanns als nationalistisch geprägtes Pamphlet einstufen zu
können. Es erübrigt sich der Hinweis, daß die genannten Ebenen und
die jeweils angeführten Aspekte nicht als eindeutig abgrenzbare, in
Multiple Choice-Manier abprüfbare Komponenten aufzufassen sind.
3 Scheitern im „Dialog“
Nur kurz nach der Publikation des Hauptmann-Artikels
antwortet Romain Rolland mit einem Offenen Brief im Journal
de Genève vom 2.9.1914 (s. Anhang, Text
(2)). Im Mittelpunkt seiner Replik stehen vor allem drei Punkte: Zum
einen sei nicht die deutsche Bevölkerung für die bisherigen – als
kriminell zu betrachtenden – Geschehnisse verantwortlich zu machen
((2) [2]). Zweitens wendet sich Rolland gegen die Ansicht, der
Krieg sei eine Frage des Schicksals (vgl. bei Hauptmann die Passage
(1) [3]), und betont das politische Versagen, die
Willenlosigkeit und die mangelnde Bewußtwerdung der betroffenen
Völker:
(2a) [2] [...] Ce n’est pas que je regarde, ainsi que vous,
la guerre comme une fatalité. Un Français ne croit pas à la
fatalité. La fatalité, c’est l'excuse des âmes sans volonté. La
guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de leur stupidité.
On ne peut que les plaindre, on ne peut leur en vouloir. [...]
Das Hauptaugenmerk gilt schließlich jedoch einem
Appell, den Rolland in ausgesprochen massiver Form an Gerhart
Hauptmann direkt richtet. Bevor es dazu kommt, wartet der Offene
Brief mit einer Einleitung auf, die die grundsätzliche, jeden
nationalen Haß ablehnende Haltung des Autors unterstreicht:
(2b) [1] Je ne suis pas, Gerhart Hauptmann, de ces Français qui
traitent l’Allemagne de barbare. Je connais la grandeur
intellectuelle et morale de votre puissante race. Je sais tout ce que
je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ; et encore à
l’heure présente, je me souviens de l’exemple et des paroles de
notre Gœthe — il est à l’humanité entière —
répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme, à ces
hauteurs « où l’on ressent le bonheur ou le malheur des
autres peuples comme le sien propre ». J’ai travaillé,
toute ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations ; et
les atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la
ruine de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à
souiller de haine mon esprit.
Rolland möchte nicht sogleich in die Reihe derer
eingeordnet werden, die Deutschland oder den Deutschen pauschal
Barbarentum unterstellen. Es ist daher kein Zufall, wenn er zu Beginn
von intellektueller und moralischer Größe spricht und hervorhebt,
in welchem Maße er sich den Denkern der « vieille Allemagne »
zu Dank verpflichtet fühlt. Ebensowenig ist es ein Zufall, wenn
Rolland sich – wie übrigens zuvor auch schon Michel Bréal in
seiner obigen Stellungnahme – auf Goethe als verbindende
Instanz beruft und mit dessen Worten gleichsam eine alle Grenzen
überschreitende Solidarität anmahnt. Auf diese Weise kann sich der
Autor als Verfechter eines europäischen Friedens positionieren,
der an den überkommenen kulturellen Werten festhält und die
gegenwärtige Politik der Zerstörung ablehnt. Darüber hinaus
wird mit dem Verweis auf die gemeinsame Wertebasis ein Maßstab
eingeführt, nach dem die aktuellen Geschehnisse zu beurteilen wären.
Diese Voraussetzungen bestimmen dann auch die Kritik und die
Vorwürfe, die Rolland gegenüber Hauptmann äußert:
Die Kritik umfaßt mehrere Etappen: Der erste Vorwurf
richtet sich gegen den Umstand, daß mit Belgien ein Land angegriffen
werde, das – wie die Deutschen in den Befreiungskriegen –
lediglich seine Unabhängigkeit verteidige; das sei nicht hinnehmbar
(« c’en est trop ! »), das Vorgehen sei eine
Schande (« quelle honte ! »). Zudem richten sich die
Angriffe nicht nur gegen das lebende Belgien, sondern mit der
Zerstörung ganzer Städte vernichte man auch die Vergangenheit
(« vous faites la guerre aux morts »). Vorläufiger
Endpunkt ist die vor diesem Hintergrund nur als rhetorische Frage zu
verstehende Äußerung « êtes-vous
les petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ? » Die hier
feststellbare Zuspitzung erscheint zwar kaum noch steigerbar,
doch Rolland fährt mit einer wortreich eingeleiteten und
persönlich adressierten Aufforderung fort. Bereits die Wahl der
Verben mutet ungewöhnlich an und zeugt von der Intensität des
Disputs (« je m’adresse contre vous », « je vous
adjure », « je vous somme »); außerdem formuliert
der Autor hier im Namen Europas, der Zivilisation, der Ehre der
germanischen Rasse (mit dreifachem « au nom de ») und
erwartet von seinem Gegenüber letztlich, mit aller Kraft gegen das
begangene Verbrechen zu protestieren:
(2d) [5] Ce n’est pas à l’opinion du reste de l’univers
que je m’adresse contre vous. C’est à vous-même, Hauptmann. Au
nom de notre Europe, dont vous avez été jusqu’à cette heure un
des plus illustres champions, — au nom de cette civilisation pour
laquelle les plus grands des hommes luttent depuis des siècles, —
au nom de l’honneur même de votre race germanique, Gerhart
Hauptmann, je vous adjure, je vous somme, vous et l’élite
intellectuelle allemande où je compte tant d’amis, de protester
avec la dernière énergie contre ce crime qui rejaillit sur vous.
Um seinem Appell weiteren Nachdruck zu verleihen, fügt
Rolland abschließend noch die folgenden metakommunikativen Zusätze
hinzu:
(2e) [7] J’attends de vous une réponse, Hauptmann, une
réponse qui soit un acte. L’opinion européenne l’attend, comme
moi. Songez-y : en un pareil moment, le silence même est un
acte.
Der Offene Brief Romain Rollands an Gerhart Hauptmann
schlägt in Deutschland ein wie eine Bombe (Cheval 1963: 302ff).
In der Presse wird der Text häufig reduziert auf den Satz
« êtes-vous les
petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ? », ohne
sich dabei auf eine wirkliche inhaltliche Debatte einzulassen. Auf
deutscher Seite betrachtet man vor allem den Vergleich mit Attila und
den als barbarisch geltenden Hunnen als nicht annehmbare Provokation,
ganz abgesehen von der Undankbarkeit, die man Rolland vorhält,
da ja sein Roman Jean-Christophe
in Deutschland sehr wohlwollend aufgenommen worden sei.
In dem Zusammenhang ist weiterhin zu berücksichtigen,
daß der Offene Brief keineswegs nur die persönliche Mitteilung an
einen deutschen Schriftsteller namens Gerhart Hauptmann
darstellt. Im Gegenteil: Es geht eher darum, öffentlich und in
aller Deutlichkeit konträre Standpunkte sichtbar zu machen,
Unvereinbarkeiten zu betonen, die Gegenseite bloßzustellen und
so die Wirksamkeit der eigenen Argumentation zu erhöhen. Die Form
des Offenen Briefs sorgt für eine Vervielfachung der Adressaten; die
Mitteilung ist zwar noch persönlich adressiert, aber nunmehr einem
prinzipiell unbegrenzten Leserpublikum zugänglich. Damit dürfte
auch zusammenhängen, daß der argumentative Austausch leicht in
eine inszenierte Schein-Diskussion übergeht – das umso mehr, als
die vertretenen Positionen sehr weit auseinanderliegen und die Chance
einer Annäherung oder einer Meinungsänderung äußerst gering ist:
L’argumentation destinée à l’autre se transforme dès lors en
lutte verbale donnée en spectacle à des tiers. Il s’agit
d’exploiter la facture de la lettre ouverte pour feindre de
s’adresser à l’allocutaire alors qu’on tente en réalité à
la fois de rallier son propre camp autour d’un étendard, et de se
donner raison aux yeux du monde civilisé. (Amossy 2004: 33)
Aufgrund der Mehrfachadressierung, die für öffentlich
präsentierte Texte generell gegeben ist, kann auch mit
unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen gerechnet werden. Das
Textverstehen ist nicht einfach und nicht ausschließlich eine
Funktion der Äußerungseigenschaften. In Abhängigkeit vom
Situationszusammenhang, vom jeweiligen Kontext und je nach
Vorinformationen und Vorerwartungen können Textmitteilungen
anders interpretiert, bewertet und eingeordnet werden. Diese
Selbstverständlichkeit gilt ebenso für den Beitrag Romain Rollands.
So gesehen, eröffnet bereits die Einleitung verschiedene
Deutungsmöglichkeiten. Mag gegenüber Hauptmann noch das
Bemühen anklingen, die Wertschätzung deutscher „Dichter und
Denker“ zu betonen, dürfte mit Blick auf andere Adressaten die
Selbstpräsentation Rollands stärker in den Vordergrund treten. Aus
der Perspektive lassen sich die Äußerungen in (2) [1] auch
verstehen als Versuch, sich als Vertreter gemeinsamer
europäischer Werte, als aktiver Verfechter einer
deutsch-französischen Verständigung darzustellen, als jemand, der
sich nicht vorschnell verbreiteten Urteilen anschließt und nicht
einfach einem blinden Pazifismus folgt. Es geht also darum, in
der hier nun öffentlich geführten Debatte eine möglichst
parteienübergreifende Position einzunehmen. Als Gesamttext
kann man den Offenen Brief zwar zunächst als Appell an Gerhart
Hauptmann, gegen die Kriegsverbrechen in Belgien zu
protestieren, auffassen – mit der Einschränkung allerdings, daß
Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Aufforderung angebracht
erscheinen; darüber hinaus dürfte der Text aber je nach
Adressatengruppe darauf abzielen, das Vorgehen des deutschen Militärs
zu verurteilen (z. B. bei deutschen Lesern), eine Unterstützung
der friedenspolitischen Bemühungen zu propagieren (z. B. in der
internationalen Öffentlichkeit), Mitgefühl, Empörung, Solidarität
zum Ausdruck zu bringen (z. B. in Belgien) oder die Ablehnung
des Krieges zu bekräftigen (z. B. bei einem gleichgesinnten
Publikum). Einen Überblick über verschiedene Lesarten gibt
Schaubild 2 wieder:
Abb. 4: Mehrfachadressierung
Die darauffolgende Antwort Gerhart
Hauptmanns, wiederum publiziert in der Vossischen
Zeitung vom 10.9.19145,
bestätigt die Unmöglichkeit des Dialogs zwischen den beiden
Autoren. Dies betrifft zunächst die inhaltliche Ebene; so wird ohne
jede Einschränkung die These vom durch Rußland, England und
Frankreich erzwungenen Krieg wiederholt ((3) [1]), und auf die
von deutschen Truppen in Belgien begangenen Massaker geht Hauptmann
konkret gar nicht erst ein. Es gibt lediglich mit der tautologischen
Formel Krieg ist Krieg
einen indirekten Hinweis, mit dem alle Einwände und
Vorhaltungen hinfällig zu sein scheinen:
(3a)
[4] Krieg ist Krieg. Sie mögen sich über den Krieg beklagen,
aber nicht über Dinge wundern, die von diesem Elementarereignis
unzertrennlich sind.
Außerdem spricht Hauptmann – unter
Verweis auf deutsche Regierungsquellen – von einem „Riesenschwall
deutschfeindlicher Lügen“ ((3) [7]) und sieht bei allem
die „französische Lügenpresse“ am Werk ((3) [5]); dazu der
kommentierende Gemeinplatz „Der zur Ohnmacht Verurteilte
greift zu Beschimpfungen“ ((3) [6]).6
Nicht minder schwer wiegen die persönlichen Vorbehalte,
die Hauptmann vorbringt:
(3b) [2] [...] Sie
haben an der Versöhnung beider Völker mit Eifer gearbeitet.
Trotzdem sehen Sie jetzt, wo der blutige Riß auch Ihr schönes
Friedenskonzept, wie so viele andere, vernichtet hat, unser Land
und Volk mit französischen Augen an: und jede Mühe wird ganz gewiß
vergeblich sein, Sie deutsch- und klarblickend zu machen.
[3]
Natürlich ist alles schief, alles grundfalsch, was Sie von unserer
Regierung, unserem Heer, unserem Volke sagen. Es ist so falsch,
daß mich in dieser Beziehung Ihr offener Brief wie eine leere,
schwarze Fläche anmutet.
Rolland sei, so Hauptmann, aufgrund seiner
„französischen Augen“ gar nicht zu einem neutralen Blick in der
Lage und Hoffnungen, ihn „deutsch- und klarblickend zu
machen“, seien „ganz gewiß vergeblich“. Insofern fehle den
Aussagen jede Glaubwürdigkeit, es sei „alles schief, alles
grundfalsch“ und der Offene Brief „wie eine leere, schwarze
Fläche“. Die wechselseitige Ablehnung und die Gegensätzlichkeit
der Positionen könnten kaum größer sein.
Es erübrigt sich daher fast der
Hinweis, daß auch mit den folgenden Stellungnahmen keine
Annäherung mehr erreicht wird, weder zwischen Rolland und Hauptmann
noch zwischen anderen Autoren, die vergleichbare
Auseinandersetzungen führen. Romain Rolland veröffentlicht
einige Tage später, am 22.9.1914, einen längeren Beitrag im Journal
de Genève unter dem
Titel « Au-dessus de la mêlée ».7
Hier wendet er sich vor allem an das „junge Europa“, über die
nationalen Grenzen hinaus, analysiert kritisch die nationalistische
Propaganda, verurteilt die Haltung der Staatschefs, wenn es darum
geht, Verantwortung zu übernehmen (« chacun s’efforce
sournoisement d’en rejeter la charge sur l’adversaire »
(2013: 68)), und kommt zu der Folgerung: « Entre nos peuples
d’Occident, il n’y avait aucune raison de guerre. » (2013:
74) Für die Hoffnung, daß sich jenseits des nationalen Hasses und
der ausgetragenen Feindseligkeiten bald wieder ein Geist der
Brüderlichkeit und der Solidarität herausbilden könnte, sieht
Rolland selbst jedoch nur geringe Chancen der Verwirklichung:
« Je sais que de telles pensées ont peu de chances d’être
écoutées, aujourd’hui. » (2013: 79)
Nimmt man die angeführten Zitate und Einlassungen von
Henri Bergson bis zur letztgenannten Stellungnahme von Romain Rolland
zusammen, bleibt als Fazit nur die Feststellung extrem verfestigter
Positionen und mehrfach blockierter Dialogversuche:
Abb. 5: Blockierter Dialog
4 Faktenabstinenz, Bildungs„ballast“
Die Besprechung der in den Abschnitten 2 und 3
herangezogenen Dokumente veranschaulicht einmal mehr, in welchem Maße
das Textverstehen von mehrdimensionalen und mehrdeutigen
Sinnzuschreibungen geprägt ist. Dieser offenkundigen
inhaltlichen Komplexität, zumal dann, wenn auch historische
Zusammenhänge angesprochen werden, können die
Kompetenzstandards des GeR kaum gerecht werden. Es ist besonders
das Abstrahieren von allem Inhaltlichen, was ein reduziertes,
stark auf die sprachliche Oberfläche bezogenes Textverstehen
begünstigt. Hierzu nochmals eine aufschlußreiche Kompetenzangabe
zum Leseverstehensbereich „Information und Argumentation
verstehen“:
C1 / C2: Kann ein weites Spektrum langer, komplexer
Texte, denen man im gesellschaftlichen, beruflichen Leben oder
in der Ausbildung begegnet, verstehen und dabei feinere Nuancen auch
von explizit oder implizit angesprochenen Einstellungen und
Meinungen erfassen. (GeR 2001: 76)
Solche Deskriptoren bleiben vage, es fehlt ein wie auch
immer gearteter Themenbezug. Genannt werden lediglich allgemeine
Kommunikationsformen (z. B. „Korrespondenz lesen und
verstehen“, „Schriftliche Anweisungen verstehen“,
„Muttersprachliche Gesprächspartner verstehen“ ...) oder
bestimmte mediale Präsentationsweisen (z. B. „Fernsehsendungen
und Filme verstehen“). Kommunizieren ohne Inhalte ist jedoch
schwierig, das dürfte selbst für den small
talk gelten. Eingängig hat dies bereits
Armin Volkmar Wernsing formuliert:
Kompetenzen und schon ihr Erwerb sind wegen der „zugrundeliegenden
Wissensbestände“, aber auch wegen der Gegenstände, an denen
sie ausgeübt werden, nie inhaltsfrei. Reiten lernt man nur mit einem
Pferd, nicht mit einem Fahrrad oder einer Gabel. Und eigentlich hätte
zu der Liste der Kompetenzen dann auch eine Liste der Gegenstände
gehört, an denen man sie zu erwerben hat. Aber dann wäre die
intellektuelle Dürftigkeit der Kompetenzpädagogik nicht zu
verbergen gewesen, die etwa zur nahezu tautologischen Definition
des Leitziels der interkulturellen Handlungsfähigkeit als
„kompetenten Umgang“ führt. (2016: 19; vgl. auch Wernsing 2008:
376)
Wie bereits eingangs betont, lassen sich Sprache und
Kultur nicht einfach trennen, auch wenn sich Meßbarkeit und
Evaluierbarkeit dabei bisweilen weniger entfalten lassen. Die
zugegebenermaßen recht spezielle Thematik der bisherigen
Ausführungen hat exemplarisch verdeutlicht, was bei der Einordnung
von Ereignissen und Sachverhalten, der Bewertung von Interessen,
Positionen und Entwicklungen sowie bei der Erklärung von
Vielschichtigkeit und Mehrfachadressierung von Textinformationen
zu berücksichtigen ist. Für das Verständnis von Anspielungen ist
nicht selten die Kenntnis „harter Fakten“ unerläßlich. Der
Zusammenhang von Textverstehen und kulturellem Wissen wird in Abb. 6
zu skizzieren versucht:
Abb. 6: Textverstehen und kulturelles Wissen
Dabei zeigt sich, daß ein solcher Zusammenhang nichts
Abgeschlossenes ist, sondern prinzipiell in verschiedene Richtungen
vertieft werden kann. So ließe sich im vorliegenden Fall der
„Dialog“ zwischen Gerhart Hauptmann und Romain Rolland um
zusätzliche, mehr oder weniger direkt anschließende Stellungnahmen
erweitern und um Perspektiven anderer Protagonisten und anderer
Länder ergänzen.
Ohne die Relevanz der Ausbildung sprachpraktischer
Fertigkeiten geringschätzen zu wollen – hier liegt ohne Frage
eine der Stärken des GeR –, stellt die inhaltliche Beliebigkeit,
der Verzicht auf soziopolitische und historische Aspekte, ein großes
Manko dar. Und über die Abkehr von bewährten Bildungszielen
kann auch der Umstand nicht hinwegtäuschen, daß Kompetenzstandards
– allen Entfachlichungs- und Entkulturalisierungstendenzen zum
Trotz – auf allen Ebenen gezielt als Bildungsstandards etikettiert
werden. Um den inhaltlich-kulturellen Erosionsprozeß zu
rechtfertigen bzw. schönzureden, wird, speziell von
bildungstechnokratischer Seite, allzu oft eine Ballast-Metaphorik
bemüht, wonach Studien- und Lehrpläne konsequent zu
„entschlacken“, „abzuspecken“, zu „entrümpeln“ oder
zu „verschlanken“ seien. Einen treffenden und prägnant
resümierenden Kommentar zu dieser unbedachten, nichtsdestoweniger
zielgerichteten Niveauverflachungs-Rhetorik liefert wiederum
Wernsing:
Wie die nicht widerlegte, sondern einfach
geschredderte Bildungs-Philosophie nicht mit fliegenden Fahnen,
sondern sang- und klanglos unterging, gegen die Ökonomie
ausgetauscht wurde, aus der Mode kam, und das innerhalb weniger
Jahre, das ist ein überaus rätselhafter Vorgang, bei dem die
Europäische Union eine unrühmliche Rolle spielt. Wie konnte man
sich von Leerformeln und Containerbegriffen wie etwa
„Leseverstehenskompetenz“ (ohne Angabe der Texte, an denen sie
wirksam werden soll) beschwatzen lassen? (Wernsing 2016: 20)
8
Es wäre zweifellos naiv, die verordnete
Kompetenzorientierung und die damit einhergehende Vernachlässigung
landeskundlicher und literarischer Lernziele als zufällig und nur
fremdsprachendidaktisch motiviert sehen zu wollen. Die Integration
von Erziehungszielen in eine umfassendere wirtschaftspolitische
Entwicklung weist – mittels der Kompetenzpädagogik –
detailliert Wernsing (2016) nach; auf die
„Verbetriebswirtschaftlichung“ und die Einflüsse eines
neoliberalen Managements im Hochschulbereich hat zuvor bereits
Knobloch (2008) hingewiesen. An politischer Kohärenz fehlt es diesen
Trends zumindest nicht.
Anhang
(1) Gerhart Hauptmann: Gegen
Unwahrheit!
[1] Wir sind ein eminent
friedliebendes Volk. Der oberflächliche Feuilletonist Bergson in
Paris mag uns immerhin Barbaren nennen, der große Dichter und
verblendete Gallomanne Mäterlinck uns mit ähnlichen hübschen
Titeln belegen, nachdem er uns früher „das Gewissen Europas“
genannt hat. Die Welt weiß, daß wir ein altes Kulturvolk sind. Die
Idee des Weltbürgertums hat nirgends tiefere Wurzeln geschlagen als
bei uns. Man betrachte unsere Übersetzungs-Literatur und nenne mir
dann ein Volk, das sich ebenso wie wir bemüht, dem Geist und der
Eigenart anderer Völker gerecht zu werden, ihre Seele liebevoll
eingehend zu verstehen.
[2] Auch Mäterlinck hat
bei uns seinen Ruhm und sein Gold gewonnen. Für einen
Salon-Philosophaster, wie Bergson, ist allerdings im Land Kants
und Schopenhauers kein Platz. Ich spreche es aus: Wir haben und
hatten keinen Haß gegen Frankreich: Wir haben einen Kultus mit der
bildenden Kunst, Skulptur und Malerei und mit der Literatur dieses
Landes getrieben. Die Wertschätzung Rodins wurde von Deutschland aus
in die Wege geleitet, wir verehren Anatole France. Maupassant,
Flaubert, Balzac wirken bei uns wie deutsche Schriftsteller. Wir
haben tiefe Zuneigung zu dem Volkstum Süd-Frankreichs.
Leidenschaftliche Verehrer Mistrals findet man in kleinen
deutschen Städten, in Gäßchen und Mansarden.
[3] Es war schmerzlich zu
bedauern, daß Deutschland und Frankreich politisch nicht Freunde
sein konnten. Sie hätten es sein müssen, weil sie Verwalter des
kontinentalen Geistesgutes, weil sie zwei große durchkultivierte
europäische Kernvölker sind. Das Schicksal wollte es anders.
Achtzehnhundertsiebzig erkämpften sich die deutschen Stämme
die deutsche Einheit und das Deutsche Reich. Unter diesen
Errungenschaften ward unserm Volk eine mehr als vierzigjährige
friedliche Epoche beschieden. Eine Zeit des Keimens, des Wachsens,
des Erstarkens, des Blühens, des Fruchttragens ohnegleichen. [...]
[7] Aber Kaiser Wilhelm der
Zweite, oberster Kriegsherr des Reiches, hat aus wahrhaftiger Seele
den Frieden geliebt und den Frieden gehalten. Unsere exakte Armee
sollte einzig der Verteidigung dienen. Wir wollten drohenden
Angriffen gegenüber gerüstet sein. Ich wiederhole: Das
deutsche Volk, die deutschen Fürsten, an der Spitze Kaiser
Wilhelm der Zweite, haben keinen anderen Gedanken gehabt, als
durch Heer und Flotte den Bienenstock des Reiches, das fleißige,
reiche Wirken des Friedens, zu sichern. [...]
[8] Der Krieg, den wir führen
und der uns aufgezwungen ist, ist ein Verteidigungskrieg. Wer
das bestreiten wollte, der müßte sich Gewalt antun. Man betrachte
den Feind an der östlichen, an der nördlichen, an der westlichen
Grenze. Unsere Blutsbrüderschaft mit Österreich bedeutet für
beide Länder die Selbsterhaltung. Wie man uns die Waffe in
die Hand gezwungen hat, das mag jeder, dem es um Einsicht, statt um
Verblendung zu tun ist, aus dem Depeschenwechsel zwischen Kaiser
und Zar sowie zwischen dem Kaiser und dem König von England
entnehmen. Freilich, nun haben wir die Waffe in der Hand, und
nun legen wir sie nicht mehr aus der Hand, bis wir vor Gott und
Menschen unser heiliges Recht erwiesen haben.
[9] Wer aber hat diesen
Krieg angezettelt? Wer hat sogar den Mongolen gepfiffen, diesen
Japanern, daß sie Europa hintertückisch und feige in die Ferse
beißen? Jedenfalls doch unsere Feinde, die, umgeben von
Kosakenschwärmen, für die europäische Kultur zu kämpfen vorgeben.
Nur mit Schmerz und mit Bitterkeit spreche ich das Wort England aus.
Ich gehöre zu denjenigen Barbaren, denen die englische Universität
Oxford ihren Doktorgrad honoris causa verlieh. Ich habe Freunde in
England, die mit einem Fuß auf dem geistigen Boden Deutschlands
stehen. Haldane, ehemals Kriegsminister, und mit ihm zahllose
Engländer traten regelmäßige Wallfahrten nach dem kleinen,
barbarischen Weimar an, wo die Barbaren Goethe, Schiller, Herder,
Wieland und andere für die Humanität einer Welt gewirkt haben.
Wir haben einen deutschen Dichter, dessen Dramen, wie keines anderen
deutschen Dichters, Nationalgut geworden sind: er heißt Shakespeare.
Dieser Shakespeare ist aber zugleich Englands Dichterfürst. Die
Mutter unseres Kaisers war eine Engländerin, die Gattin des
englischen Königs ist eine Deutsche. Und doch hat diese stamm- und
wahlverwandte Nation uns die Kriegserklärung ins Haus geschickt.
Warum? Der Himmel mag es wissen.
[10] Soviel ist gewiß, daß
das nun eröffnete bluttriefende Weltkonzert in einem englischen
Staatsmann seinen Impresario und Dirigenten hat. Allerdings ist die
Frage, ob das Finale dieser furchtbaren Musik noch den gleichen
Dirigenten am Pult sehen wird. „Mein Vetter, Du hast es nicht gut
gemeint, weder mit Dir selbst noch mit uns, als Deine Werkzeuge den
Mordbrand in unsere Hütten warfen.“ Während ich diese Worte
schreibe, ist der Tag der Sonnenfinsternis vorübergegangen. Die
deutsche Armee hat zwischen Metz und den Vogesen acht französische
Armeekorps geworfen, und sie sind auf der Flucht. Wer als Deutscher
inmitten des Landes lebt, fühlte: es sollte, es mußte so kommen.
Man legte uns einen eisernen Ring um die Brust, und so wußten wir,
diese Brust mußte sich dehnen, mußte den Ring sprengen oder aber zu
atmen aufhören. [...]
[11] Durch den
vollständigen Sieg deutscher Waffen wäre die Selbständigkeit
Europas sichergestellt. Es würde darauf ankommen, den
Völkerfamilien des Kontinents begreiflich zu machen, daß
dieser Weltkrieg der letzte unter ihnen bleiben muß. Sie müssen
endlich einsehen, daß ihre blutigen Duelle nur demjenigen
schmählichen Vorteil einbringen, der, ohne mitzukämpfen, sie
anstiftet. Dann müssen sie einer gemeinsamen, tiefkulturellen
Friedensarbeit obliegen, die Mißverständnisse unmöglich
macht.
[12] Es war in dieser
Beziehung vor dem Kriege schon viel geschehen. Im friedlichen
Wettstreit fanden sich die Nationen und sollten sich noch zuletzt in
den Olympischen Spielen zu Berlin finden. Ich erinnere an die
Wettflüge, Wettfahrten, Wettrennen, an die internationale
Wirksamkeit von Kunst und Wissenschaft und die große internationale
Preisstiftung. Das Barbarenland Deutschland ist, wie man weiß, den
anderen Völkern mit großartigen Einrichtungen sozialer Fürsorge
vorangegangen. Ein Sieg müsste uns verpflichten, auf diesem Wege
durchgreifend weiter zu gehen und die Segnungen solcher Fürsorge
allgemein zu verbreiten.
[13] Unser Sieg würde
fernerhin dem germanischen Völkerkreise seine Fortexistenz zum
Segen der Welt garantieren. [...]
[14] Ich höre, daß man im
Ausland eine Unmenge lügnerische Märchen auf Kosten unserer Ehre,
unserer Kultur und unserer Kraft zimmert. Nun, diejenigen, die da
Märchen fabulieren, mögen bedenken, daß die gewaltige Stunde dem
Märchenerzähler nicht günstig ist. An drei Grenzen steht unsere
Blutzeugenschaft. Ich selbst habe zwei meiner Söhne
hinausgeschickt. Alle diese furchtlosen deutschen Krieger wissen
genau, für was sie ins Feld gezogen sind. Man wird keinen
Analphabeten darunter finden. Aber desto mehr solche, die neben dem
Gewehr in der Faust, ihren Goethischen Faust, ihren Zarathustra, ein
Schopenhauersches Werk, die Bibel oder Homer im Tornister haben.
Und auch die, die kein Buch im Tornister haben, wissen, daß sie für
einen Herd kämpfen, an dem jeder Gastfreund sicher ist.
[15] Auch jetzt hat man bei
uns keinem Franzosen, Engländer oder Russen ein Haar gekrümmt oder
gar, wie im Lande des empfindsamen Herrn Mäterlinck, an wehrlosen
Opfern, einfachen, einsässigen deutschen Bürgern und Bürgerfrauen,
grausamsten, fluchwürdigen, nichtsnutzigen, bestialischen
Meuchelmord geübt. Ich gebe auch Herrn Mäterlinck speziell die
Versicherung, daß niemand in Deutschland daran denkt, sich von
solchen Handlungen einer Kulturnation etwa zur Nachahmung reizen zu
lassen. Wir wollen und werden lieber weiter deutsche Barbaren sein,
denen die vertrauensvoll unsere Gastfreundschaft genießenden Frauen
und Kinder unserer Gegner heilig sind. Ich kann ihm versichern, daß
wir, bei aller Achtung vor einer „höheren Gesittung“ der
französisch-belgischen Zunge, uns doch niemals dazu verstehen
werden, belgische Mädchen, Weiber und Kinder in unserem Land feige
unter qualvollen Martern hinzuschlachten.
[16] Wie gesagt: An den
Grenzen steht unsere Blutzeugenschaft, der Sozialist neben dem
Bourgeois, der Bauer neben dem Gelehrten, der Prinz neben dem
Arbeiter, und alle kämpfen für deutsche Freiheit, deutsches
Familienleben, für deutsche Kunst, deutsche Wissenschaft, deutschen
Fortschritt; sie kämpfen mit vollem, klarem Bewußtsein für einen
edlen und reichen Nationalbesitz, für innere und auch äußere
Güter, die alle dem allgemeinen Fortschritt und Aufstieg der
Menschheit dienstbar sind.
(Vossische Zeitung 26.8.1914)
(2) Lettre ouverte à Gerhart Hauptmann
Samedi 29 août 1914
[1] Je ne suis pas, Gerhart
Hauptmann, de ces Français qui traitent l’Allemagne de barbare. Je
connais la grandeur intellectuelle et morale de votre puissante race.
Je sais tout ce que je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ;
et encore à l’heure présente, je me souviens de l’exemple et
des paroles de notre Gœthe — il est à l’humanité entière —
répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme, à ces
hauteurs « où l’on ressent le bonheur ou le malheur des
autres peuples comme le sien propre ». J’ai travaillé, toute
ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations ; et les
atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la ruine
de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à souiller
de haine mon esprit.
[2] Quelques raisons que
j’aie donc de souffrir aujourd’hui par votre Allemagne et de
juger criminels la politique allemande et les moyens qu’elle
emploie, je n’en rends point responsable le peuple qui la subit et
s’en fait l’aveugle instrument. Ce n’est pas que je regarde,
ainsi que vous, la guerre comme une fatalité. Un Français ne croit
pas à la fatalité. La fatalité, c’est l'excuse des âmes sans
volonté. La guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de
leur stupidité. On ne peut que les plaindre, on ne peut leur en
vouloir. Je ne vous reproche pas nos deuils ; les vôtres ne
seront pas moindres. Si la France est ruinée, l’Allemagne le sera
aussi. Je n’ai même pas élevé la voix, quand j’ai vu vos
armées violer la neutralité de la noble Belgique. Ce forfait contre
l’honneur, qui soulève le mépris dans toute conscience droite,
est trop dans la tradition politique de vos rois de Prusse ; il
ne m’a pas surpris.
[3] Mais la fureur avec
laquelle vous traitez cette nation magnanime, dont le seul crime est
de défendre jusqu’au désespoir son indépendance et la justice,
comme vous-mêmes, Allemands, l’avez fait en 1813 c’en est trop !
L’indignation du monde se révolte. Réservez-nous ces violences à
nous Français, vos vrais ennemis ! Mais vous acharner
contre vos victimes, contre ce petit peuple belge infortuné et
innocent !... quelle honte !
[4] Et non contents de vous
en prendre à la Belgique vivante, vous faites la guerre aux morts, à
la gloire des siècles. Vous bombardez Malines, vous incendiez
Rubens. Louvain n’est plus qu’un monceau de cendres, — Louvain
avec ses trésors d’art, de science, la ville sainte ! Mais
qui donc êtes-vous ? et de quel nom voulez-vous qu’on vous
appelle à présent, Hauptmann, qui repoussez le titre de barbares ?
Êtes-vous les petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ?
Est-ce aux armées que vous faites la guerre, ou bien à l’esprit
humain ? Tuez les hommes, mais respectez les œuvres !
C’est le patrimoine du genre humain. Vous en êtes, comme nous
tous, les dépositaires. En le saccageant, comme vous faites, vous
vous montrez indignes de ce grand héritage, indignes de prendre rang
dans la petite armée européenne qui est la garde d’honneur de la
civilisation.
[5] Ce n’est pas à
l’opinion du reste de l’univers que je m’adresse contre vous.
C’est à vous-même, Hauptmann. Au nom de notre Europe, dont vous
avez été jusqu’à cette heure un des plus illustres champions, —
au nom de cette civilisation pour laquelle les plus grands des hommes
luttent depuis des siècles, — au nom de l’honneur même de votre
race germanique, Gerhart Hauptmann, je vous adjure, je vous
somme, vous et l’élite intellectuelle allemande où je compte tant
d’amis, de protester avec la dernière énergie contre ce crime qui
rejaillit sur vous.
[6] Si vous ne le faites
point, vous montrez de deux choses l’une, — ou bien que vous
l’approuvez (et alors que l’opinion du monde vous écrase !)
— ou bien que vous êtes impuissants à élever la voix contre les
Huns qui vous commandent. Et alors, de quel droit pouvez-vous encore
prétendre, comme vous l’avez écrit, que vous combattez pour la
cause de la liberté et du progrès ? Vous donnez au monde la
preuve qu’incapables de défendre la liberté du monde, vous l’êtes
même de défendre la vôtre, et que l’élite allemande est
asservie au pire despotisme, à celui qui mutile les chefs-d’œuvre
et assassine l’Esprit humain.
[7] J’attends de vous une
réponse, Hauptmann, une réponse qui soit un acte. L’opinion
européenne l’attend, comme moi. Songez-y : en un pareil
moment, le silence même est un acte.
(Romain Rolland, Journal de
Genève 2.9.1914)
(3) Antwort an Herrn Romain
Rolland
[1] Sie richten, Herr
Rolland, öffentliche Worte an mich, aus denen der Schmerz über den
(von Rußland, England und Frankreich erzwungenen) Krieg hervorgeht,
der Schmerz über die Gefährdung der europäischen Kultur und den
Untergang geheiligter Denkmäler alter Kunst. Diesen allgemeinen
Schmerz teile ich. Allein ich verstehe mich nicht dazu, eine Antwort
zu geben, die Sie mir im Geiste schon vorgeschrieben haben und von
der Sie mit Unrecht behaupten, daß ganz Europa sie erwarte.
[2] Ich weiß, daß Sie
deutschen Blutes sind. Ihr schönes Buch „Johann Christoph“ wird
unter uns Deutschen neben dem „Wilhelm Meister“ und dem „Grünen
Heinrich“ immer lebendig sein. Frankreich wurde Ihr
Adoptiv-Vaterland. Darum muß Ihr Herz jetzt zerrissen, Ihr Urteil
ein getrübtes sein. Sie haben an der Versöhnung beider Völker
mit Eifer gearbeitet. Trotzdem sehen Sie jetzt, wo der blutige Riß
auch Ihr schönes Friedenskonzept, wie so viele andere, vernichtet
hat, unser Land und Volk mit französischen Augen an: und jede Mühe
wird ganz gewiß vergeblich sein, Sie deutsch- und klarblickend zu
machen.
[3] Natürlich ist alles
schief, alles grundfalsch, was Sie von unserer Regierung, unserem
Heer, unserem Volke sagen. Es ist so falsch, daß mich in dieser
Beziehung Ihr offener Brief wie eine leere, schwarze Fläche
anmutet.
[4] Krieg ist Krieg. Sie
mögen sich über den Krieg beklagen, aber nicht über Dinge wundern,
die von diesem Elementarereignis unzertrennlich sind. Gewiß ist es
schlimm, wenn im Durcheinander des Kampfes ein unersetzlicher Rubens
zugrunde geht, aber – Rubens in Ehren! – ich gehöre zu jenen,
denen die zerschossene Brust eines Menschenbruders einen weit
tieferen Schmerz abnötigt. Und, Herr Rolland, es geht nicht an, daß
Sie einen Ton annehmen, als ob Ihre Landsleute, die Franzosen, mit
Palmwedeln gegen uns zögen, wie sie doch in Wahrheit mit Kanonen,
Kartätschen, ja, sogar mit Dum-Dum-Kugeln reichlich versehen sind.
[5] Gewiß sind Ihnen
unsere heldenmütigen Armeen furchtbar geworden! Das ist der Ruhm
einer Kraft, die durch die Gerechtigkeit ihrer Sache unüberwindlich
ist. Aber der deutsche Soldat hat mit den ekelhaften und läppischen
Werwolfgeschichten nicht das allergeringste gemein, die Ihre
französische Lügenpresse so eifrig verbreitet, der das französische
und belgische Volk sein Unglück verdankt.
[6] Mag uns ein müßiger
Engländer „Hunnen“ nennen, mögen Sie meinethalben die Krieger
unserer herrlichen Landwehr als Attilas Söhne bezeichnen. Es ist uns
genug, wenn diese Landwehr den Ring unserer unbarmherzigen Feinde
zerschmettert. Weit besser, Sie nennen uns Söhne Attilas,
machen drei Kreuze über uns und bleiben außerhalb unserer
Grenzen, als daß Sie uns eine empfindsame Inschrift, als den
geliebten Enkeln Goethes, auf das Grab unseres deutschen Namens
setzen. Das Wort von den „Hunnen“ ist von solchen Leuten geprägt,
die sich, selber Hunnen, in ihren verbrecherischen Anschlägen auf
das Leben eines gesunden und kerntüchtigen Volkes getäuscht sehen,
weil dieses Volk einen furchtbaren Stoß noch furchtbarer zu parieren
verstand. Der zur Ohnmacht Verurteilte greift zu Beschimpfungen.
[7] Ich sage nichts gegen
das belgische Volk. Der friedliche Durchzug deutscher Truppen, eine
Lebensfrage für Deutschland, wurde von Belgien nicht gewährt, weil
sich seine Regierung zum Werkzeug Englands und Frankreichs gemacht
hatte. Dieselbe Regierung hat dann, um ihren verlorenen Posten zu
stützen, einen Guerilla-Kampf ohnegleichen organisiert und dadurch –
Herr Rolland, Sie sind Musiker! – die schreckliche Tonart der
Kriegführung angegeben. Wenn Sie eine Möglichkeit haben wollen,
durch den Riesenwall deutschfeindlicher Lügen sich
hindurchzuarbeiten, so lesen Sie einen Bericht unseres Reichskanzlers
vom 7. September an Amerika, lesen Sie ferner das Telegramm, das am
8. September der Kaiser selbst an den Präsidenten Wilson richtete.
Sie erfahren dann Dinge, die zu wissen notwendig sind, das Unglück
von Löwen zu verstehen.
(Gerhart Hauptmann, Vossische
Zeitung 10.9.2014)
Bibliographie
Amossy, Ruth (2004). Dialoguer au cœur du conflit ? Lettres
ouvertes franco-allemandes,
1870/1914. In: Mots. Les langages du politique 76
(2004), 25-39.
Baumann, Christian & Tobias Benzing (2013): Output-Orientierung
und Kompetenzformulierung im Bologna-Prozess. Würzburg:
Julius-Maximilians-Universität.
Bergson, Henri (1972). Mélanges. Textes publiés par André
Robinet. Paris: P.U.F.
Blume, Otto-Michael (2015). Im Wunderland der Kompetenzen – Und wo
bleiben die Inhalte? In: Französisch heute 46
(2015), 29-36.
Bréal, Michel (1891). Le langage et les nationalités. In: Revue
des deux mondes 108
(1891), 615-639.
Bréal, Michel (1913). La neutralisation de l’Alsace-Lorraine. In:
La paix par le droit 23
(1913), 36.
Cheval, René (1963). Romain Rolland, l’Allemage et la guerre.
Paris: P.U.F.
Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit (Hrsg.)
(2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für
Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin: Langenscheidt.
Gesser, Gerhard (2006). Was erwartet Lehramtsanwärter Französisch
heute? In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 45
(2006), 3-14.
Große, Ernst Ulrich (2008). Deutsch-französische Beziehungen. In:
Große, Ernst Ulrich & Heinz-Helmut Lüger (62008):
Frankreich verstehen. Eine Einführung mit Vergleichen zu
Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
300-346.
Jeismann, Manfred (1992). Das Vaterland der Feinde. Studien zum
nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Frankreich und
Deutschland 1792-1918. Stuttgart: Klett-Cotta.
Knobloch, Clemens (2008). Das Neuakademische. Anmerkungen zur Sprache
der unternehmerischen Hochschule. In: Aptum. Zeitschrift für
Sprachkritik und Sprachkultur 4
(2008), 147-170.
Lüger, Heinz-Helmut (2013). Bologna – ein „vernünftiger
Ansatz“? Anmerkungen zum bildungspolitischen Zeitgeist. In:
Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 53
(2013), 85-96.
Lüger, Heinz-Helmut (2015). Kommunikation in der Krise. Reden zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In: Weigt, Zenon et al. (Hrsg.)
(2015). Felder der Sprache – Felder der Forschung. Didaktische
und linguistische Implikationen. Łódź: Universitätsverlag,
9-29.
Lüger, Heinz-Helmut (2016). Textverstehen und Kompetenzorientierung.
In: Bürgel, Christoph & Dirk
Siepmann (Hrsg.) (2016).
Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik: Zum Verhältnis
von sprachlichen Mitteln und Kompetenzentwicklung.
Baltmannsweiler: Schneider, 217-239.
Mainard, Louis (1885). Le livre d‘or de la patrie. Paris:
Publications populaires.
Quinet, Edgar (1842). La Teutomanie. In: Revue des deux mondes 32
(1842), 927-938.
Rössler,
Andrea (2007): Standards ohne Stoff? Anmerkungen zum Verschwinden
bildungsrelevanter Inhalte aus den curricularen Vorgaben für den
Französisch- und Spanischunterricht. In: Beiträge zur
Fremdsprachenvermittlung 46 (2007), 3-20.
Rolland, Romain (1915/2013). Au-dessus de la mêlée. Paris:
Payot.
Rolland, Romain & Stefan Zweig (2014). Von Welt zu Welt.
Briefe einer Freundschaft 1914-1918. Berlin: Aufbau.
Schröder, Konrad (2005). Kommt nach dem „PISA-Schock“ der
„DESI-Schock“? Sprachenzertifikate, PISA, DESI, die
Bildungsstandards und die neue „Evaluationskultur“ an
unseren Schulen. In: Neusprachliche Mitteilungen 58
(2005), 36-47.
Sieburg, Manfred (2007). Kompetent oder gebildet? In: Engagement.
Zeitschrift für Erziehung und Schule
3 (2007), 184-194.
Wernsing, Armin Volkmar (2008). Leidet die Lehrerausbildung unter
zu viel Bildung? Eine Erwiderung. In: Französisch heute
39 (2008), 374-378.
Wernsing, Armin Volkmar (2015). Notwehr Literatur. In: Französisch
heute 46 (2015), 23-28.
Wernsing,
Armin
Volkmar (2016).
Lonely Rider.
Das
neoliberale Subjekt und die Bil-dung. In: Beiträge
zur Fremdsprachenvermittlung 57
(2016), 3-22.
Zydatiß, Wolfgang (2008). SMS an KMK: Standards mit Substanz! In:
Lüger, Heinz-Helmut & Andrea Rössler (Hrsg.) (2008): Wozu
Bildungsstandards? Zwischen Input- und Outputorientierung in der
Fremdsprachenvermittlung. Landau: VEP, 13-34.
---------------------------
1 Verwiesen sei u.a. auf die Stellungnahmen von Schröder (2005),
Rössler (2007), Sieburg (2007), Wernsing (2008, 2016), Zydatiß
(2008), Lüger (2013) und Blume (2015).
2 Der
vorliegende Beitrag ergänzt die Ausführungen in Lüger (2016); um
unnötige Wiederholungen zu vermeiden, sei auf Begriffsbestimmungen
und historische Informationen in diesem Text verwiesen.
3 Es
scheint eine verbreitete Haltung deutscher Intellektueller zu sein,
die Vorkommnisse in Belgien leugnen zu wollen und sie einer
propagandistischen Berichterstattung der ausländischen Presse
zuzuschreiben. Man denke nur an das „Manifest der 93: An die
Kulturwelt!“ vom 4.10.1914
und an die „Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen
Reiches“ vom 16.10.1914, wo bekannte künstlerische und
wissenschaftliche Persönlichkeiten wie Rudolf Eucken, Gottlob
Frege, Fritz Haber, Otto Hahn, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Max
Planck, Karl Vossler, Wilhelm Wundt und natürlich auch Gerhart
Hauptmann sich ganz im Sinne der Politik der deutschen
Reichsregierung äußern. – Selbst ein später eher
pazifistisch eingestellter Autor wie Stefan Zweig tritt 1914 – z.B.
in seinem Briefwechsel mit Romain Rolland – noch als vehementer
Verfechter des deutschen Vorgehens auf, behauptet, Löwen wäre gar
nicht zerstört worden, und macht für anderslautende Berichte die
französische Presse verantwortlich (Rolland & Zweig 2014:
48ff).
4 Das
vor Napoleon stehende Schaf spielt an auf die Luxemburg-Krise von
1867, auf den Versuch Frankreichs, mit dem Erwerb Luxemburgs sein
Territorium zu erweitern. Der Konflikt wird schließlich mit einer
von den europäischen Großmächten garantierten
Neutralitäts-Erklärung Luxemburgs beigelegt.
5 Siehe
Anhang, Text (3). Eine französische Übersetzung des Beitrags findet
sich in Cheval (1963: 298-300).
6 Bereits
am 26.8.1914 behauptet Gerhart Hauptmann, „daß man im Ausland eine
Unmenge lügnerische Märchen auf Kosten unserer Ehre, unserer Kultur
und unserer Kraft zimmert“ und erklärt negative Informationen als
Märchenerzählerei (vgl.
(1) [14]).
7 Der
Text wird wieder aufgenommen in dem 1915 publizierten Buch Romain
Rollands mit dem gleichen Titel Au-dessus de la mêlée. Eine
Neuausgabe erscheint 2013; die Seitenangaben zu den Zitaten beziehen
sich auf diese Ausgabe.
8 Vgl.
Blume (2015: 33), der ebenfalls die Gefahr sieht, daß „im
Unterricht vor lauter Standardorientierung das Wesentliche verloren
zu gehen droht – der Inhalt und seine bildende Bedeutung für die
Lernenden“.